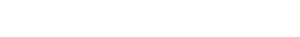Utoya 22. Juli (2018)

- Originaltitel Utøya 22. Juli
- Regie Erik Poppe
- DarstellerInnen
- Entstehungsjahr 2018
- Land Norwegen
- Filmlänge 98 min
- Filmstart 20.9.2018
- FSK 12
- Genres
Bewertung
Für die 18-Jährige Kaja beginnt ein Überlebenskampf, als Anders Breivik ein Attentat auf der Insel Utoya verübt
Filminhalt
Reale Tragödien filmisch aufzuarbeiten, ist immer ein Drahtseilakt – erst recht, wenn sie kaum sieben Jahre in der Vergangenheit liegen. So war es vorauszusehen, dass „Utøya 22. Juli“ auf der Berlinale so kontrovers diskutiert werden würde. Und so wird es sicher auch der US-Version „Norway“ gehen, die dieser Tage beim Filmfestival von Venedig uraufgeführt wird. Er wolle mit seinem Film an die Opfer erinnern und ihnen ein Gesicht geben, sagt „Utøya“-Regisseur Erik Poppe, während alle Welt nur über den Täter spreche: Anders Behring Breivik, Massenmörder und Rechtsextremist, der am 22. Juli 2011 auf der norwegischen Insel Utøya 69 Jugendliche erschoss. Es ist ein valides Argument, dem menschenfeindlichen, zerstörerischen Gedankengut eines Attentäters, der noch im Gerichtssaal den Hitlergruß zeigte, kein Podium zu geben. Aber was haben die Opfer tatsächlich von diesem Film – und was die Zuschauer? Es kann niemals eine Rechtfertigung dafür geben, anderen Menschen das Leben zu nehmen. Andererseits kann ein Mensch, der zu einem Terroranschlag oder Amoklauf fähig ist, dutzende potenzielle Vorwände dafür finden. Man kann Breivik also mit Recht für einen Wahnsinnigen halten, dessen Motive im Grunde austauschbar sind. Aber in einer Zeit, in der rechtes Gedankengut wieder an die Oberfläche drängt und in vielen Ländern sogar von Regierungsseite legitimiert wird, ist es auch fahrlässig, eine solche Tat zu entpolitisieren.
„Utøya 22. Juli“ arbeitet mit zynischen Tricks
Die Ideen, die potenziellen Tätern als Rechtfertigung dienen könnten, müssen benannt werden, um ihnen entgegenwirken zu können. Breivik hat den Ort seines Anschlags, ein sozialdemokratisches Feriencamp, mit Bedacht gewählt. Er wollte die regierenden Sozialdemokraten für ihre Migrationspolitik bestrafen; die Jugendlichen waren für ihn politische Aktivisten, die für den von ihm verhassten Multikulturalismus arbeiteten. Im Film ist Breivik nur einmal als Silhouette in der Ferne zu sehen, er bleibt ein gesichtsloses Monster. Und so gänzlich losgelöst von ihrem Kontext wird auch die Tat selbst austauschbar: Man könnte über jeden Anschlag einen solchen Film drehen. Die filmische Qualität von „Utøya 22. Juli“ ist zugleich das Problem: das Als-wäre-man-dabei-Moment. Damit man möglichst intensiv nachfühlen kann, wie es wohl war, von einem Irren mit Gewehr über eine Insel gehetzt zu werden, inszeniert Poppe sein fiktionalisiertes Reenactment als Plansequenz – der Film ist in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht. Dabei arbeitet er mit dramaturgischen Tricks, die letztlich zynisch sind. Von Anfang an spielt er mit dem Zuschauerwissen um die Katastrophe. Wenn etwa die Hauptfigur Kaja mit ihrer Mutter telefoniert und ihr versichert, dass sie sich am sichersten Ort der Welt befinde, denkt man sofort: Von wegen! Kurz darauf schallen Schreie durch das Camp. Geht es etwa schon los? Kaja erschreckt sich – und wir uns mit ihr. Doch es sind nur herumalbernde Camper. Poppe gibt Katja auch eine Mission: Sie muss ihre Schwester Emilie suchen, und während um Kaja herum die Jugendlichen um ihr Leben schreien, rennen, flehen, legt der Film falsche Fährten aus, emotionalisiert zusätzlich, als wäre das Massaker noch nicht Grauen genug. Wäre „Utøya 22. Juli“ ein Horrorfilm, man müsste ihn loben für seine Effektivität und seine Dichte. Als Film, der einem realen Trauma beikommen will, ist er vor allem ausbeuterisch. Wenn auch mit den besten Absichten. sb