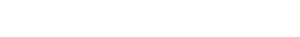The Master (2012)
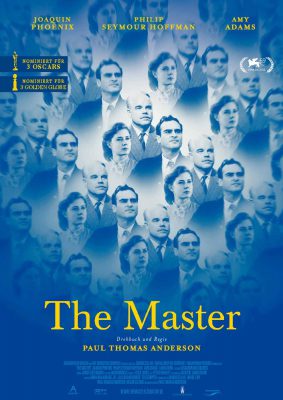
- Originaltitel The Master
- Regie Paul Thomas Anderson
- DarstellerInnen
- Buch Paul Thomas Anderson
- Entstehungsjahr 2012
- Land USA
- Filmlänge 137 min
- Filmstart 21.2.2013
- FSK 12
- Genres
Bewertung
Filminhalt
Die debil schiefgezogene Oberlippe, die hängenden Schultern samt greisenhaft gewölbtem Rücken, als wolle er sich in sich selbst verkriechen, dazu ein nervös-irres Lachen, der Soundtrack zu wilden Aggressionen, die durch den Konsum von Torpedotreibstoff und selbstgebranntem Fusel unkontrollierbar werden: Als Freddie Quell (Joaquin Phoenix) am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Pazifik zurückkehrt, ist er ein zerstörtes Individuum, war es vielleicht vorher schon, der Vater tot, die Mutter in der Anstalt. Phoenix spielt diesen onanierenden Kobold nach vier Jahren Leinwandpause am Rande des Overacting, mit der Energie eines Menschen, in dem noch ein anderer Mensch wohnt, mit dem er sich im Widerstreit befindet. Freddie trifft auf Lancaster Dodd (zwischen behütend, charmant und tyrannisch: Philip Seymour Hoffman), der sich von seinen Anhängern nur Meister nennen lässt und sie in spirituellen Sitzungen zurück in der Zeit reisen lässt, damit sie ihre früheren Ichs treffen. Dodds Lehre nach sind alle immer schon dagewesen, alle fechten seit Billionen Jahren einen Kampf aus. Er nimmt sich Freddies an und integriert ihn in seine Glaubensgemeinschaft. Paul Thomas Anderson („Magnolia“, „There will be Blood“) orientiert sich in seiner Geschichte eng an der Entstehungszeit von L. Ron Hubbards „Dianetik“ im Jahr 1950 und der Gründung der Church of Scientology.
„The Master“ handelt vom Menschen als Doppelwesen
Einer Zeit, in der der amerikanischen Gesellschaft zwischen dem gewonnen, aber traumatisierendem Krieg und dem wachsenden Wohlstand auf dem Weg in eine moderne, vielversprechende Zukunft der Sinn abhanden kam – wovon Heilsverkünder wie Hubbard profitierten, indem sie die verwirrten Seelen mit Ersatzreligionen köderten. „The Master“ ist jedoch kein Sektenfilm. Er handelt in der Figur des Freddie vor allem vom Homo duplex, dem Menschen als einem Doppelwesen, das hin- und hergerissen ist zwischen seinen animalischen Instinkten – evolutionsbiologisch: kämpfen, fliehen, essen, reproduzieren – und dem Wunsch, sich den sozialen Regeln und Normen zu beugen und die Kontrolle über sich zu erringen. Dodd will den labilen Freddie zähmen und heilen – doch kann ein zwischen Trieb und Gehorsam changierendes Wesen überhaupt zivilisiert werden? Und ist Freddie nicht auch eine Verkörperung der Seele Amerikas, diesem Land des waffenstarrenden Hinterwäldlertums und des hochentwickelten Pioniergeistes? Anderson hat „The Master“ auf seltenem 65-Millimeter-Filmmaterial gedreht, um die nostalgische Optik und Atmosphäre des amerikanischen Kinos der 1950er-Jahre heraufzubeschwören. Die von kräftigen Farben und Hochglanz dominierten Bilder von Ausflugsschiffen, Warenhäusern, Südseestränden oder klassischen Ostküstenhäuser stehen in Kontrast zu Andersons postmoderner, fragmentarischer Erzählweise.
Zwischen Vernunft und Wahn
Daraus entsteht eine Art optisches Ohrfiepen und eine Verunsicherung der Sehgewohnheit, als spielte man Zwölftonmusik zur Präsentation eines Edward-Hopper-Gemäldes. Akustisches Äquivalent dieser Stimmung ist die Musik von Radiohead-Gitarrist Johnny Greenwood: sanfte Streicher, die sich in Höhen aufschwingen, abrupt herabstürzen, um als brausender Bienenschwarm die Dissonanzen in Freddies Kopf wiederzugeben, die auch in synkopischem Jazz zum Ausdruck kommen. In der Beziehung zwischen Freddie und Dodd, so sagt das, gibt es keinen Ruhepunkt, es droht ständig die Eskalation – ob Freddie nun Kritiker seines Mentors verprügelt oder trotz auf den Rücken gefesselter Hände fast eine Gefängniszelle zerlegt. Phoenix und Seymour Hoffman wurden bei den Filmfestspielen von Venedig als beste Schauspieler ausgezeichnet, Anderson erhielt den Regiepreis. Zu Recht – denn keiner schafft es in seinen Filmen immer wieder so genau, den Grat abzufilmen, auf dem der Mensch wandelt zwischen Vernunft und Wahn. (vs)