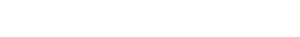Spencer (2021)

- Originaltitel Spencer
- Regie Pablo Larraín
- DarstellerInnen
- Entstehungsjahr 2021
- Land Großbritannien
- Filmlänge 117 min
- Filmstart 13.1.2022
- FSK 12
- Genres
Bewertung
Filminhalt
Pablo Larraín neuer Film nimmt sich das Leben von Lady Di vor. Doch Spencer ist am besten, wenn er sich von der Realität entfernt.
Prinzessin Diana war lange vor Instagram die meistfotografierte Frau der Welt, ihr Leben ist minutiös dokumentiert. Für die, die es nicht bewusst miterlebt haben, ist ihre bis heute andauernde Popularität bisweilen schwer nachzuvollziehen. Diana hat sogar Fans auf beiden Seiten der Monarchie-Debatte: Fans des britischen Königshauses lieben sie sowieso, aber auch die, die die Familie Windsor für verwöhnte Relikte halten, sehen in ihr oft das noch am ehesten akzeptable Mitglied. Wie kann man eine Biografie über die 1997 Verunglückte drehen, die dem Mythos noch Neues hinzufügt? Pablo Larraín versucht es erst gar nicht. Sein Spencer ist kein eigentliches Biopic, sondern eine „Fabel nach wahren Begebenheiten“, wie ein Text am Anfang des Films klarstellt.
Wie schon 2016 mit „Jackie“ konzentriert sich Larraín auf einen sehr kurzen Zeitraum im Leben seiner Protagonistin, in diesem Fall Weihnachten im Jahr 1991. Die Königsfamilie feiert auf einem Landsitz. Diana (Kristen Stewart) ist ganz in der Nähe aufgewachsen, als ihr Nachname noch Spencer war, doch das Haus ihrer Kindheit ist verrammelt – eine treffende Metapher für verlorenes Glück. Denn in der Gegenwart ist Dianas Ehe zu dem untreuen Charles (Jack Farthing) zerrüttet, sie fühlt sich vom Rest der Familie ausgeschlossen, und nach den üppigen Mahlzeiten erbricht sie alles wieder in die Kloschüssel. Diana hat Angst, den Verstand zu verlieren. Wir hören, dass das Anwesen von Paparazzi belagert wird.
Die Konzentration in Zeit und Raum verschafft Spencer unverhoffte Freiheiten, die aus der Biografie einen psychologischen Horrorfilm machen. Larraín sperrt uns förmlich in Dianas Kopf, verwischt die Grenze zwischen Wirklichkeit und Halluzination. Die Prinzessin hat Visionen von Anne Boleyn, die Heinrich VIII. einst köpfen ließ, weil er eine andere heiraten wollte. Hier und in anderen Momenten setzt Larraín auf dezente visuelle Metaphern: ein Militärlaster, dessen Reifen nur knapp die Leiche eines Fasans verfehlen, eine Perlenkette, die Diana hinunterzuwürgen glaubt, ein Billardtisch, der zum Austragungspunkt eines Ehestreits wird. In vielen Szenen ist Jonny Greenwoods Soundtrack die Geheimwaffe des Films: Er lässt die Atmosphäre in einer Sekunde von beschaulich zu verstörend kippen, wechselt fließend zwischen barock anmutendem Klavierspiel und kakofonischem Free Jazz.
Stewart als Diana stöckelt blass und gehetzt durch die langen Korridore, die bei allem Prunk etwas Klaustrophobisches bekommen. Ohne ihre Performance als Zentrum würde „Spencer“ implodieren, doch Stewart entwickelt einen tragischen Magnetismus: Wir wollen wegsehen, um uns Dianas Leid zu ersparen – können es aber nicht.
Und was ist mit den Fans? Diejenigen, die Diana als lächelnde Lichtgestalt im Gedächtnis haben, werden den Film womöglich als Verleumdung abtun. Und wer die Mimik oder Stimme der echten Prinzessin von Wales minutiös studiert hat, mag an Stewarts Spiel einiges auszusetzen haben. Der Rest der Königsfamilie, der in Spencer denkbar schlecht wegkommt, wird wohl auch wenig erfreut sein. Zudem hat Larraíns Inszenierung von Dianas Zusammenbruch stellenweise etwas Voyeuristisches.
Beim Schauen von Spencer jedoch treten alle Bedenken in den Hintergrund. Tatsächlich ist es möglich, dass der Film umso besser funktioniert, je weniger man über die wirkliche Diana weiß. Dann kann man den Film genießen als das, was er ist: ein dunkles Märchen über eine Frau, die um Selbstbestimmung kämpft – und um ihr Leben.
Matthias Jordan