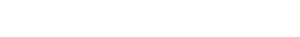AschheimBob Marley: One Love (2024)

- Originaltitel Bob Marley
- Regie Reinaldo Marcus Green
- DarstellerInnen
- Entstehungsjahr 2024
- Land USA
- Filmlänge 108 min
- Filmstart 15.2.2024
- FSK 12
- Genres
Bewertung
Filminhalt
Dass Bob Marleys Botschaft von der Liebe selbst in Zeiten des größten Erfolgs überlebt hat, verdankt er seiner Frau Rita. Und so ist das Biopic „Bob Marley – One Love“ nicht nur die Geschichte einer Ikone.
„Bohemian Rhapsody“, „Rocketman“, „Elvis“: Ein kurzer Schwenk durch die Geschichte der Popmusik reicht aus, um etliche Biografien mit bestem Biopic-Potenzial auszumachen. Natürlich eignen sich Popstars wie Freddie Mercury, Elton John oder Elvis Presley ideal für betörendes Popkornkino, sind und waren sie doch alle – zumindest in ihren besten Jahren – glamouröse Persönlichkeiten. Mit „Bob Marley – One Love“ inszeniert Reinaldo Marcus Green („King Richard“) nun eine Antithese zum westlichen Blitzlichtgewitter-Biopic. Die Geschichte einer ikonischen Figur, die zeit ihres Lebens stets darum bemüht war, den Hype um die eigene Person und den Superstarstatus charmant herunterzuspielen und dennoch schnell zur Galionsfigur eines ganzen Genres aufgestiegen ist.
Jamaika, 1976. In Kingston herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände. Offen ausgetragene Gewalt und Militärkonvois prägen das Stadtbild, und während die konservative JLP versucht, Kingston endlich zu übernehmen, verweigert die sozialdemokratische Regierung jedwede Kooperation. Eigentlich wollte sich Bob Marley (Kingsley Ben-Adir) immer von politischen Kämpfen fernhalten, der Instrumentalisierung widerstehen. Trotzdem spielt er in diesem Jahr ein Friedenskonzert, initiiert von der Sozialdemokratischen Partei. Wenige Tage vorher stürmen bewaffnete Männer sein Haus, schießen auf ihn, seine Frau Rita (Lashana Lynch) und seinen Manager Don Taylor (Anthony Welsh). Alle drei überleben. Ein einschneidendes Ereignis insofern, als Marley daraufhin seinen Wohnsitz nach London verlegt.
Zwischen Nächten in Punkklubs, freizeitlichen Fußballeinheiten und Meetings mit findigen Labelpromotern (Michael Gandolfini), die Marley vergebens Vermarktungstipps andrehen und ihm eine Afrikatour ausreden, entsteht „Exodus“. Ein legendäres Album, durch das der philanthropische Marley bald in ganz Europa zum Star wird, auf Dinnerpartys in Paris abhängt und allmählich sein Mojo zu verlieren droht. Wäre da nicht Rita.
So ist dieser Film nicht nur deshalb eine Absage an jeglichen Geniekult, weil sich Marley selbst nie als Genie verstanden hat, sondern auch, weil Rita – die nach einigen Affären ihres Mannes jeden Grund dazu gehabt hätte, ihn links liegenzulassen – der eigentliche Star dieser Geschichte ist. Mit all ihrer Liebe, Güte und Kraft verkörpert sie den spirituellen Subtext, den Rastafari-Glauben, der den gesamten Film umhüllt. Versteht Marley seine Musik als Vehikel dieser liebevollen Botschaft, ist sie es, die ihn, bereits von Hautkrebs befallen, zu einer Heimkehr bewegt. Schließlich spielt er 1978 erneut ein Friedenskonzert auf Jamaika. Diesmal reichen sich mit Michael Manley und Edward Seaga zwei führende Politiker der verfeindeten Lager sogar buchstäblich die Hände auf der Bühne. Rita wusste es die ganze Zeit: „Manchmal muss der Botschafter zur Botschaft werden“.