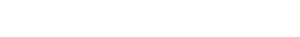12 Years a Slave (2013)
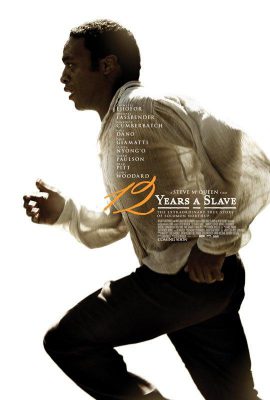
- Originaltitel 12 Years a Slave
- Regie Steve McQueen
- DarstellerInnen
- Buch John Ridley
- Entstehungsjahr 2013
- Land USA
- Filmlänge 134 min
- Filmstart 16.1.2014
- FSK 12
- Genres
Bewertung
Filminhalt
Wieder begleitet der britische Künstler und Regisseur Steve McQueen den Leidensweg eines Mannes, nach einem IRA-Sträfling im Hungerstreik in „Hunger“ (2008) und dem sexsüchtigen Yuppie in „Shame“ (2011). Diesmal ist es nicht Michael Fassbender, dem McQueen körperlich und schauspielerisch alles abverlangt. In „12 Years a Slave“ ist es Landsmann Chiwetel Ejiofor, an dem McQueen den Kampf eines Mannes um seine Würde exemplifiziert, ein Mann, der die Ketten seiner Qual abwerfen will, wortwörtlich und nach einer wahren Geschichte. Solomon Northup (Ejiofor) spaziert im Jahr 1841 als frei lebender Afroamerikaner durch Saratoga Springs in New York. Er grüßt und wird gegrüßt, ist anerkanntes Mitglied der Gemeinde, im Hardware-Store gern gesehener Stammkunde – kein Vergleich zu den Gräueln der Sklaverei, die andere Afro-Amerikaner im Süden der USA erleiden müssen. Und genau dorthin wird der Familienvater Solomon von Sklavenhändlern verschleppt, die den Nachschub für die Plantagen, den sie nach dem Gesetz nicht mehr aus Übersee beschaffen dürfen, im eigenen Land besorgen. Solomon ist nun ein Nigger und wird verkauft, an den unberechenbaren Alkoholiker Edwin Epps – Michael Fassbender verkörpert hier den Wahnsinn des weißen Systems. Nach anfänglicher Verzweiflung schreit Solomon seinen Mitgefangenen seine Strategie entgegen: „Ich werde überleben! Ich werde mich nicht der Verzweiflung hingeben! Ich werde mich abhärten, bis die Chance auf die Freiheit kommt!“ Zwölf ganze Jahre wird Solomon auf diese Chance warten müssen …
Solomon Northup will leben
McQueen legt seiner Hauptfigur nicht die Bürde auf, stellvertretend für Millionen versklavter Menschen zu leiden, er macht keinen Jesus aus ihm. Dennoch steht Solomons Einzelschicksal für das, was eine menschenverachtende Institution wie die Sklaverei mit einem gutmütigen, sanften Menschen macht: Northup will leben – also muss er andere verletzen und zurücklassen. „12 Years a Slave“ ist nicht nur die Geschichte des Solomon Northup, es ist auch eine Erzählung über ein weißes Herrschaftssystem, das sich 25 Jahre vor seinem endgültigen Untergang durch den Sezessionskrieg und die Abschaffung der Sklaverei 1865 mit aller Härte an seine Privilegien klammert. Doch genau wie Solomon letztlich nicht niederzuringen ist, so dämmert am Horizont der Geschichte schon das Ende des rassistischen Regimes – umso tiefere Kerben reißen die Peitschen in die Rücken der Leibeigenen, umso absurder geraten die Tanz- und Musizierabende, die die Sklaven zur Unterhaltung des cholerischen Epps aufführen müssen. McQueen inszeniert das ungewöhnlich konventionell – von einigen theaterhaften Szenen und suggestiven Kamerafahrten durch subtropische Sumpfwälder und Baumwollfelder abgesehen, die die Ausweglosigkeit von Solomons Situation kongenial einfangen.
„12 Years a Slave“ ist ein Fanal für die Menschlichkeit
Der Film stellt mit nüchterner Akkuratesse und nötiger Brutalität seine Geschichte in den Vordergrund, nicht den Stil. Vielleicht auch, weil er die eher konservativen Oscar-Juroren nicht mit filmischer Extravaganz verprellen will. In dieser Chronik einer Ungerechtigkeit glänzt Chiwetel Ejiofor („Children of Men“, „2012“) als Opfer, das sich weigert, sich selber so zu betrachten, um nicht den Glauben an eine lebenswerte Zukunft zu verlieren – ob er dazu andere Sklaven auspeitschen oder die demütigenden Rolle des tumben Niggers spielen muss. Und man vergisst diesen Solomon Northup nicht, diesen Prototypen des freien, individuierten, ja, modernen Menschen – der von weißem Abschaum den Status eines Hundes erhält. „12 Years a Slave“ ist ein Fanal für die Menschlichkeit, obwohl er von Unmenschlichkeit handelt. (vs)